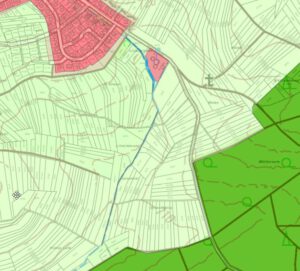Bei der Bewirtschaftung von forstlichem Eigentum werden durch die Eigentümer Ziele formuliert. Oft geschieht das um so intensiver, ja größer der Forstbetrieb ist. In kleinen oder kleinsten privaten Forstbetrieben gibt es nur ganz selten eine umfangreiche mittelfristige Planung und ein Zielesystem. Auf diesen Flächen wird nicht regelmäßig gearbeitet, nur alle paar Jahre erfolgt Nutzung – manchmal geplant, manchmal ungeplant durch Wind, Schnee oder Insektenbefall.
Noch seltener als bei der Nutzung gibt es in Kleinstforstbetrieben in den weiteren forstlichen Betätigungsfeldern konkrete Zielsetzungen: Waldverjüngung, Waldschutz, Bestandespflege oder Erschließung. In öffentlichen Forstbetrieben liegt im 10-Jahresrhythmus geordnet nach den Waldorten eine umfangreiche Planung vor, daraus werden Jahrespläne abgeleitet und mit den Körperschaften abgestimmt. In größeren Forstbetrieben wird deshalb auch regelmäßig die Waldverjüngung unter die Lupe genommen.
Die Waldverjüngung kann prinzipiell auf natürliche Weise erfolgen, dabei werfen unsere Waldbäume ihre Samen ab, die dann nach dem Keimen für die nächste Baumgeneration sorgen. Daneben ist auch die künstliche Begründung durch Pflanzung oder seltener auch als Saat möglich. Künstlich begründet wird vor allem dann, wenn keine Samenbäume zur Verfügung stehen, die Wiederbewaldung schnell erfolgen soll oder ein Wechsel der Baumarten angestrebt wird.
Die junge Baumgeneration in der Krautschicht konkurriert dabei mit den Pflanzen der Krautschicht. Vor allem Grasbewuchs oder Bodenbewuchs durch Brombeeren machen unseren Forstpflanzen zu schaffen, außerdem abiotische einflüsse wie Wetter und Witterung und biotische Schädlinge wie bestimmte Käfer oder Mäuse. Am stärksten beeinflusst aber der Verbiss von Rehwild, Hasen und neuerdings auch Damwild das Wachstum der jungen Bäumchen. Vor allem Reh- und Damwild fressen die jungen Knospen und Triebe ab.
In Baden-Württemberg formuliert das Landeswaldgesetz eine Pflicht zur Wiederaufforstung (§17 LWaldG BW) von Waldflächen die, aus welchen Gründen auch immer, kahl gelegt wurden. Viele Forstbetriebe möchten ihre Waldflächen durch Naturverjüngung bereits verjüngen bevor das letzte Altholz darüber geerntet wird, so entstehen überhaupt keine Kahlflächen. Wer also Waldflächen seines Forstbetriebs verjüngen oder wieder in Bestockung bringen möchte oder muss stellt sich einer großen Herausforderung: Zur Verjüngung eines Waldes müssen die Rahmenbedingungen stimmen! Witterung, Konkurrenzflora, Lichteinfall im Bestand, Naturverjüngung oder Pflanzgut und möglichst wenig Verbiss durch Wild müssen über mehrere Jahre und Vegetationszyklen stimmen.
Waldverjüngung ist ein erheblicher Kostenfaktor für Forstbetriebe, Kulturflächen anzulegen und über Jahre zu pflegen kostet Geld. Kommen Wildschutzmaßnahmen hinzu wird es noch teurer und wenn durch Wildverbiss nachgepflanzt oder über mehr Jahre als notwendig Kultursicherung betrieben werden muss schlägt das deutlich zu Buche.
An dieser Stelle prallen vielerorts die Ziele der Waldeigentümer und die Vorstellungen der Jagdausübungsberechtigten aufeinander: Die Forstbetriebe erwarten möglichst wenig Wild und Verbissdruck damit die Waldverjüngung funktioniert, Jäger wünschen sich einen möglichst zahlreichen Wildbestand zur Ausübung ihres Hobbies.
Wichtig für die Forstbetriebe sind deshalb angepasst Wildbestände. Der PEFC Standard definiert angepasste Wildbestände in seinem Standard (PEFC D 1002-1:2020, 4.11):
… „Wildbestände gelten dann als angepasst, wenn
- die Verjüngung der Hauptbaumarten ohne Schutzmaßnahmen möglich ist,
- die Verjüngung der Nebenbaumarten gegebenenfalls mit vertretbarem Aufwand gesichert werden kann und
- frische Schälschäden an den Hauptbaumarten nicht großflächig auftreten.“
Ist das nicht der Fall muss der PEFC-zertifizierte Forstbetrieb auf angepasste Wildbestände hinwirken. Das kann er auf unterschiedliche Weise tun:
- Forstbetrieb bildet einen Eigenjagdbezirk: Eigentümer selbst bejagt in Regie und kann damit Wilddichte und Verbiss selbst einregeln
- Verpachteter Eigenjagdbezirke: Eigentümer nimmt im Rahmen der Verpachtung über den Pachtvertrag Einfluss auf die Jagdausübung
- Forstbeitriebe als Teil eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks:
- Einbringen in die Arbeit der Jagdgenossenschaft
- Dokumentation der waldgerechten Wildbewirtschaftung
- Einflussnahme auf Abschussfestsetzung und die Gestaltung von Jagdpachtverträgen
- Angabe und Geltendmachung von Wildschäden
- Hinwirken auf jährlichen Waldbegang
Ist eine Verjüngung ohne Schutz nicht möglich bleibt dem Forstbetrieb meist nur Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder Wildschäden anzumelden. Dazu mehr im Teil 4 und 5 unserer Infoserie.